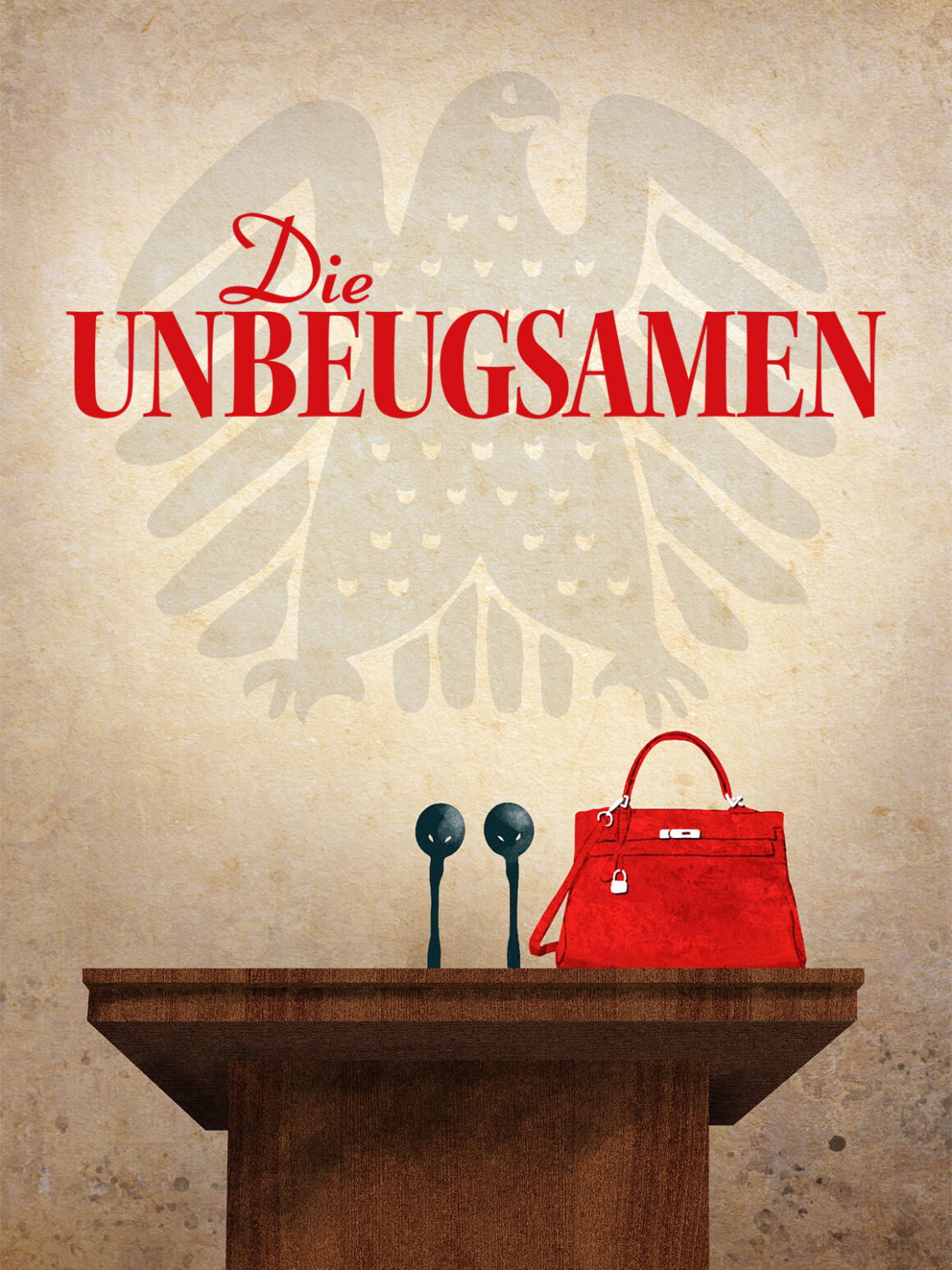THERESA VON AVILA (1515−1582) war eine außergewöhnliche Mystikerin, Kirchenreformerin und die erste Frau, die von der katholischen Kirche als Kirchenlehrerin anerkannt wurde – 1970 durch Paul den VI. Ihre Positionen zur Rolle der Frau, ihr Verhältnis zu Männern und ihre kritischen, oft provokanten Äußerungen lassen sich mit folgenden Aspekten und Zitaten belegen:
Theologische und spirituelle Positionen
Selbst- und Gotteserkenntnis: Sie prägte die Mystik als „Erfahrungswissen von Gott“. Für sie war die Suche nach Gott im eigenen Inneren und die Verbindung von Selbst- und Gotteserkenntnis zentral.
Wert und Charisma der Frau: Sie sah die Gotteserfahrung in Frauen wie in Männern gleichermaßen und betonte, dass jede Verletzung der Menschenwürde – ob gegen Frauen oder Männer – eine Beleidigung Gottes ist. Sie war überzeugt, dass „Gott Frauen diesen Gunsterweis [mystische Erfahrung] viel öfter als Männern schenkt“.
Beitrag von Frauen für Kirche und Gesellschaft: Sie war der Überzeugung, dass Frauen bedeutende Gaben und Charismen in die Kirche einbringen können. Als Reformerin setzte sie dies praktisch um, indem sie den Karmelorden reformierte und zahlreiche Klöster gründete – auch gegen massiven Widerstand kirchlicher Autoritäten und Theologen.
Haltung gegenüber Männern und kirchlichen Autoritäten
Theresa verteidigte selbstbewusst den Wert der Frauen. Sie schrieb humorvoll-streitbare Briefe an hochgestellte Männer (u.a. den Papst) und scheute den Disput mit den besten theologischen Köpfen nicht.
Sie zeigte, dass Autorität und Charisma nicht an das Geschlecht gebunden sind. Karl Rahner sagte zu ihrer Ernennung als Kirchenlehrerin: „Das Charisma der Lehre ist kein Privileg des Mannes […] die Vorstellung, als ob die Frau in geistiger und religiöser Hinsicht die Unbegabtere sei, wird damit verworfen.“
Provokante und deutliche Zitate
„Ich bin ein Weib – und obendrein kein gutes.“ Diese ironische Selbstdistanzierung nutzte Theresa, um die Rolle der Frau in der Kirche zu unterstreichen und subtile Kritik zu üben.
„Ich werfe unserer Zeit vor, dass sie starke und zu allem Guten begabte Geister zurückstößt, nur weil es sich um Frauen handelt.
Im Dialog mit Jesus fühlte sie sich von ihm bestätigt: „…du bist ein gerechter Richter und nicht wie die Richter dieser Welt, denen (…) jede Tugend der Frau verdächtig erscheint. (…) Aber wenn ich unsere Welt von heute sehe, dann finde ich es nicht gerecht, dass Menschen mit einem tugendhaften und starken Gemüt verachtet werden, einzig und allein weil sie Frauen sind.“ Theresa forderte, sich von überkommenen Strukturen zu lösen, um in Freiheit Neues zu wagen, „die Bereitschaft, Altes loszulassen, konkret auch Institutionen aufzugeben, um frei ‚von‘ und damit frei ‚für‘ zu sein.“ – eine direkte Provokation für eine beharrende Kirchenhierarchie.
„Es ist schwer, seinen Verstand jemand unterzuordnen, der keinen hat. Ich habe das nie vermocht.“
„Kein Zweifel, dass ich inzwischen mehr Angst vor denen habe, die so viel Angst vor DEM BÖSEN haben, als vor ihm selbst.“
DOROTHEE SÖLLE (1929–2003) Sölle gehörte zu den profiliertesten Vertretern eines „anderen Protestantismus“. Sie versuchte in ihren Schriften, alltägliche Lebenserfahrungen – insbesondere des Leidens, der Armut, der Benachteiligung und Unterdrückung – mit theologischen Inhalten zu verknüpfen. Eine Anerkennung im Wissenschaftsbetrieb blieb ihr weitgehend versagt.
Politische und feministische Theologie
Sie verband Theologie von Anfang an mit gesellschaftlichem Engagement („politische Theologie“). Sie verstand Glauben nicht als privates Trostpflaster, sondern als Antrieb zu sozialem und politischem Widerstand gegen Ungerechtigkeit. Sie trat für eine Kirche ein, in der Männer und Frauen als gleichberechtigte Subjekte des Glaubens und Handelns wirken.
Neue Gottesbilder und weibliche Spiritualität
Sölle lehnte die Vorstellung von Gott als patriarchalen „Herrscher“ ab und plädierte für ein Gottesverständnis, das Beziehung, Mitgefühl und gegenseitige Ermächtigung betont. In ihren Gedichten, Gebeten und theologischen Texten suchte sie nach einer weiblichen Sprache über Gott: „Wir müssen Gott so lieben, dass es aufhört, eine männliche Angelegenheit zu sein.“
Biblische Gerechtigkeit und Befreiung
Sölle betonte, dass der Glaube an den Gott der Bibel stets das Engagement für Gerechtigkeit und Menschenrechte einschließt. Die alttestamentlichen Propheten und Jesus sind für sie Vorbild und Begründung für zivilen Ungehorsam und Solidarität mit Ausgegrenzten – unabhängig vom Geschlecht. Besonders das Lukas-Evangelium und die Aussagen zur Ebenbildlichkeit (Genesis 1) nutzt sie als Argument für Geschlechtergerechtigkeit.
Radikale Kritik an männlich-geprägter Kirche
Sölle kritisierte scharf die „Herrenherrlichkeit“ in Kirche und Theologie, die Frauen eine passive oder untergeordnete Rolle zuschreiben. Wenn Frauen am Altar ausgeschlossen werden: „Das ist die Konsequenz aus einer Gottesvorstellung, die lieber einen Mann ans Kreuz nagelt, als eine Frau Brot austeilen lässt.“ Sie argumentierte, dass die Kirche Jesu von den Erniedrigten ausgeht – zu denen auch die Frauen gehören – und nur dann glaubwürdig bleibt, wenn sie die Wirklichkeit von Frauen wahrnimmt und ihre Teilhabe ermöglicht. Sölle scheute keine Kontroverse – immer aus dem Geist prophetischen Protestes nach biblischem Vorbild. Sie nannte Dogmen die Frauen abwerten eine „Gotteslästerung“.
Plädoyer für solidarische Gemeinschaft und Teilhabe
Sölle verstand Christsein als Praxis der Gleichheit und Geschwisterlichkeit: Nicht Autoritäten zählen, sondern die Erfahrung und Praxis der gegenseitigen Ermächtigung („empowerment“). Sie rief gerade Frauen und alle Christen dazu auf, die eigene Stimmen zu erheben, Leitungsaufgaben zu übernehmen und die Bibel aus der Perspektive der Unterdrückten zu lesen und zu leben.
Provokante und deutliche Zitate
„Stell dir vor, Gott ist eine Frau. Sie ist schwarz. Sie ist aus Afrika. Sie wartet auf Gerechtigkeit, auf Freiheit, auf Kinder, die leben.“
„Es gehört zu den Krankheitszeichen unserer Religion, dass Frauen über viele Jahrhunderte hin begreifen mussten: Ich bin nicht gemeint, wenn von Gott gesprochen wird.“
„Glauben heißt, sich nicht abfinden.“
„Auf Gott darf man nur hoffen, wenn man bereit ist, im Namen Gottes Unrecht nicht zu akzeptieren.“
GEBET
Gerechter Gott,
du hast uns alle nach deinem Bild geschaffen –
gleich an Würde, gleich an Wert,
gleich berufen, dein Reich mitzugestalten.
Doch wir erleben, dass diese Gleichheit oft übersehen wird:
In unseren Kirchen, in unseren Familien, in unserer Arbeit.
Wir bringen dir die Stimmen, die überhört werden,
die Gaben, die nicht anerkannt werden,
die Frauen, die kämpfen müssen, um gehört zu werden,
und die Männer, die lernen müssen, neu zu sehen.
Mach uns aufmerksam und mutig, Ungleichheit nicht hinzunehmen
und Verantwortung zu teilen.
Jesus Christus, erneuere unsere Gemeinschaft,
dass wir Strukturen hinterfragen und miteinander wachsen.
Denn nur gemeinsam spiegeln wir dein Bild –
Mann und Frau, gleichwertig, gemeinsam auf dem Weg.
Hilf uns glaubwürdig zu leben und Kirche zu sein. Amen.